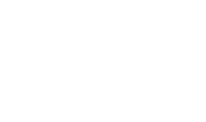Das Gefängnis Spandau, 1918-1947 : Strafvollzug in Demokratie und Diktatur
Rudolf Heß fast nur durch diesen Namen ist das Gefängnis Spandau heute noch bekannt. Hier, im Alliierten Kriegsverbrechergefängnis in Berlin-Spandau, verbüßte der Stellvertreter Adolf Hitlers 40 Jahre seiner Haftstrafe bis zu seinem Tod 1987. Doch die Geschichte des Gefängnisses Spandau beginnt bereits früher. Johannes Fülberth geht dieser Geschichte von 1919 1947 nach. Detailliert und quellengesättigt untersucht er die Zustände in der Haftanstalt von der Weimarer Republik über das Dritte Reich bis hin zu dessen Zusammenbruch und den ersten Jahren unter der Herrschaft der Alliierten. Anhand einzelner Gefangenenschicksale sowie Personalakten von Beamten, Unterlagen der aufsichtführenden Behörden und bisher unveröffentlichter Fotos rekonstruiert er den Alltag in dem Gefängnis, die gesundheitlichen wie hygienischen Verhältnisse und den Umgang zwischen Aufsehern und Insassen sowie den Insassen untereinander. So entsteht eine anschauliche Darstellung der Welt hinter den Mauern, die vor den Augen der Öffentlichkeit sonst weitgehend verborgen bleibt. Seine Ergebnisse ordnet der Autor stets in den politischen, sozialen und wirtschaftlichen Kontext der Zeit ein. Das Gefängnis Spandau ist allerdings nicht nur eine Abhandlung über eine einzelne Haftanstalt: Der staatliche Umgang mit Delinquenten und die Auffassung darüber, warum ein Mensch zum Straftäter wird, geben Aufschluss über das Menschenbild und das Selbstverständnis der Weimarer Republik einerseits und des NS-Regimes andererseits.-- Originally presented as the author's thesis (doctoral)--Freien Universität Berlin, 2012. 364 pages : some illustrations ; 25 cm.
- Fülberth, Johannes, 1979-
- NIOD Bibliotheek
- Text
- ocn930547516
- Prisons--Germany--Berlin--History--20th century.
- War criminals--Germany--Berlin--History--20th century.
- Detention of persons--Germany--Berlin--History--20th century.
- Spandau Prison (Berlin, Germany)--History.
Bij bronnen vindt u soms teksten met termen die we tegenwoordig niet meer zouden gebruiken, omdat ze als kwetsend of uitsluitend worden ervaren.Lees meer